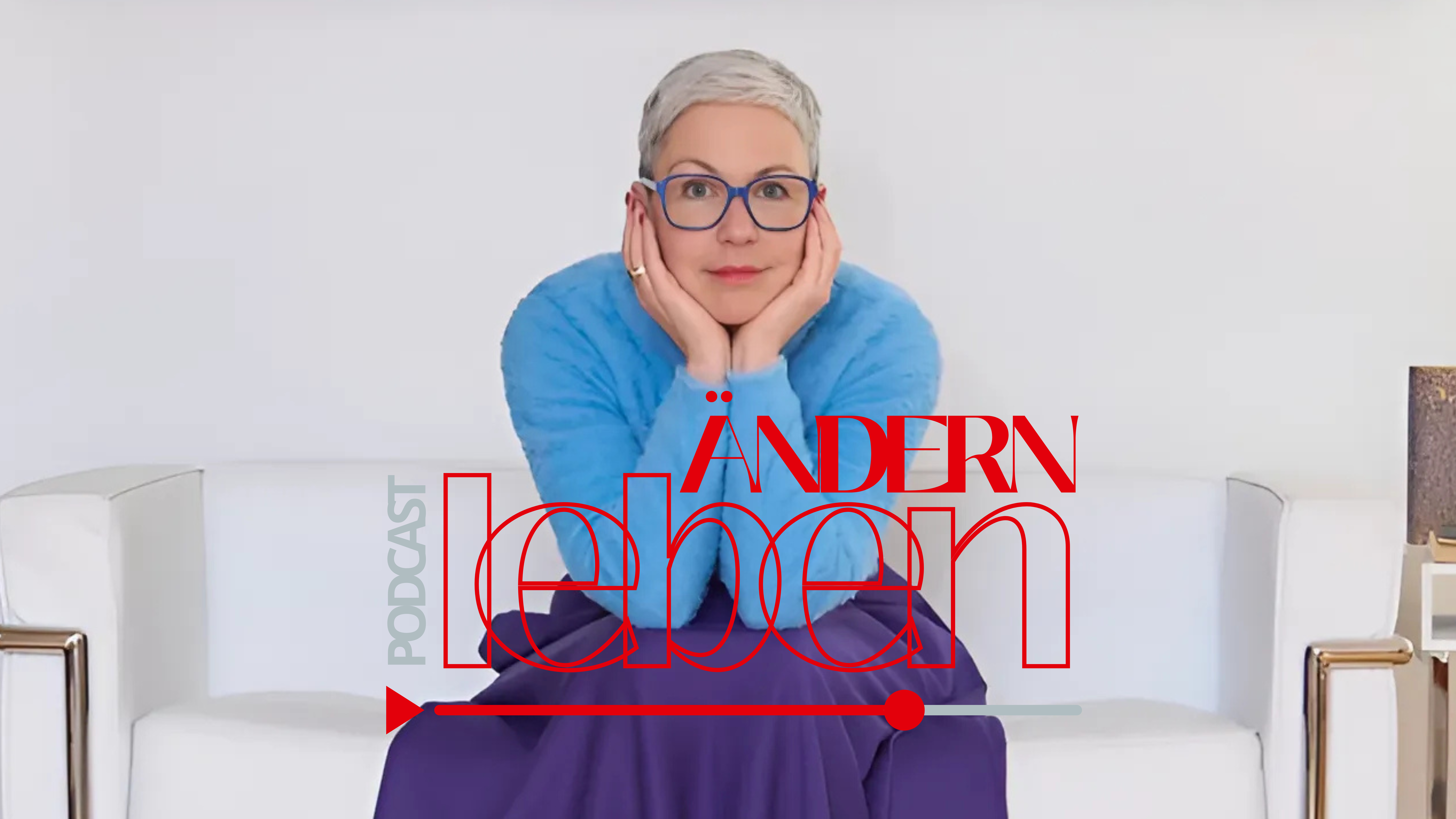» XIII. Folge | Julia Grinberg
Die Schriftstellerin Julia Grinberg, wäre die Literatur eine Staffel von White Lotus, ist die Rebellin, die die Party crashed, zu der sie selbst eingeladen hat. Vor wenigen Tagen, am 1. Juni, schrieb sie auf ihrem Blog: „I did it my way. Heute vor 25 Jahren habe ich eine Grenze überschritten.“ Es war allerdings nicht die erste Grenze, die die Dichterin überschritt.
Tochter eines Offiziers der Roten Armee übersiedelte die Familie der 1970 geborenen Julia Grinberg von Kaserne zu Kaserne – von Kazan, wolgaaufwärts nach Saratov, dann kurzzeitig an den Pazifik nahe Japan, anschließend in die DDR und schließlich ins ukraninische Dnipro, wo Julia Grinberg den größten Teil ihrer frühen Sozialisation erlebte, zur Schule ging und Chemie studierte. Welche Emotionen hinter dem gegenwärtigen Konflik in der Ukraine mitschwingen, begreift Julia Grinberg auf eine komplexe und vielschichte Weise. Sie organisierte nicht schon in den ersten Tagen des Krieges Hilfskonvois nach Lwiw, sondern begann auch ukrainisch, anstatt russisch zu sprechen.
Zugleich thematisierte in ihrem Lyrik-Debüt das, was Luftwurzeln sind. Zusammen mit Yevgeniy Breyger gründet sie in Frankfurt am Main Jahre vorher den „Salon Fluchtentier.“ Und jetzt veröffentlichte die Dichterin aus dem Rheingau im Elif Verlag das „Journal einer Unzugehörigkeit.“ Wer dieses poetische Journal aufmerksam verfolgt, wird nicht eingesogen in ein Knäul poetisch dargebotener Zweifel und Unbehagen. Vielmehr entwirft Julia Grinberg im Wechsel von prosaisch-tagesjournalartiger Notate und poetischer Abbreviaturen einen Weg von zunehmender Souveränität, darin auch die Schönheit dieser Texte besteht.